Obwohl die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) meist mit der Kindheit in Verbindung gebracht wird, besteht sie häufig bis ins Erwachsenenalter fort. Rund 2,5 % der Erwachsenen weltweit erfüllen die diagnostischen Kriterien, wobei die Prävalenz mit zunehmendem Alter allmählich auf etwa 1 % ab 60 Jahren sinkt. Dieses Absinken bedeutet jedoch nicht, dass die Störung verschwindet; vielmehr werden die Symptome oft subtiler, besser kompensiert oder von Ärzt:innen seltener erkannt. Viele Erwachsene, die die formalen Diagnosekriterien nicht (mehr) erfüllen, leiden weiterhin unter Konzentrationsschwäche, Desorganisation und emotionaler Impulsivität.
Bis zu 70 % der Kinder mit ADHS zeigen auch im Erwachsenenalter weiterhin deutliche Symptome, selbst wenn die Diagnose formal entfällt.
Wird einheitlich diagnostiziert, ergeben sich weltweit ähnliche Raten, doch die Zahl der erkannten Erwachsenen variiert je nach Gesundheitssystem und öffentlicher Aufklärung.
In der Schweiz lag der Anteil der Erwachsenen, die in 2025 mit Stimulanzien behandelt wurden, bei rund 0,6 – 0,8 % der Bevölkerung,deutlich niedriger als in den USA, wo etwa 6 % der Erwachsenen entsprechende Medikamente erhielten. Diese Unterschiede spiegeln vermutlich unterschiedliche gesundheitspolitische und kulturelle Faktoren wider. Die tiefere Behandlungsprävalenz in der Schweiz, trotz einer geschätzten ADHS-Rate von rund 4 % bei erwachsenen Männern, deutet auf eine Unterdiagnostizierung oder eine stärkere Nutzung nicht-pharmakologischer Behandlungsformen hin, während in den USA medikamentöse Therapien deutlich verbreiteter sind.
Diagnostische Kriterien und Screening im Erwachsenenalter

Die ADHS wird bei Erwachsenen in der Schweiz nach den DSM-5-Kriterien diagnostiziert und erfordert in der Regel einen multimodalen Behandlungsansatz. Dieser umfasst meist eine Kombination aus Medikation (z. B. Methylphenidat) und nicht-pharmakologischen Verfahren wie Psychotherapie bzw. kognitiv-behaviorale Therapie.
Die diagnostischen Standards wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt, um die Realität von ADHS über die gesamte Lebensspanne hinweg abzubilden. Das DSM-5 (2013) senkte die Zahl der erforderlichen Symptome für die Diagnose bei Erwachsenen von sechs auf fünf, um anzuerkennen, dass sich ADHS nach der Adoleszenz anders manifestiert. Ohne diese Anpassung wäre fast die Hälfte der betroffenen Erwachsenen nicht als diagnostisch relevant eingestuft worden.
Das DSM-5 definiert ADHS weiterhin als neuroentwicklungsbedingte Störung mit Beginn in der Kindheit. Dabei ist jedoch eine wichtige Nuance zu beachten: Viele Menschen suchen erst im Jugend- oder Erwachsenenalter professionelle Hilfe – oft dann, wenn ihre zuvor wirksamen Kompensationsstrategien den steigenden Anforderungen von Beruf und Alltag nicht mehr standhalten.
Fachpersonen sollten eine ADHS im Erwachsenenalter nicht vorschnell ausschliessen, wenn keine klare Kindheitsanamnese vorliegt. Unterstützende Umfelder, hohe Intelligenz oder eine stark strukturierte Erziehung können frühe Symptome kaschieren und die Diagnose verzögern.
Moderne diagnostische Instrumente
Die aktuelle Diagnostik kombiniert strukturierte klinische Interviews mit validierten Ratingskalen wie die WHO Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) oder das DIVA-5-Interview. Fachleute warnen davor, sich allein auf Fragebögen zu stützen; Angehörigen Informationen oder Schulberichte können entscheidend sein.
Kein Labor- oder bildgebendes Verfahren kann ADHS derzeit zuverlässig diagnostizieren. Analysen von Hunderten von Studien haben gezeigt, dass keine genetischen, biochemischen oder neuroimaging-basierten Marker über ausreichende Sensitivität und Spezifität verfügen, um klinische Entscheidungen zu leiten. Neuroimaging- und EEG-Untersuchungen sind daher weiterhin hilfreich, um andere Erkrankungen auszuschliessen, eignen sich jedoch nicht zur Bestätigung einer ADHS-Diagnose.
Digitale Innovationen in der ADHS-Diagnostik
Digitale Innovationen verändern zunehmend, wie die ADHS in der klinischen Praxis diagnostiziert wird. Zwar kann bislang kein computergestütztes System ein vollständiges klinisches Interview ersetzen, doch verschiedene technologische Ansätze werden bereits als ergänzende Instrumente eingesetzt, um Diagnosen zu objektivieren und Abläufe effizienter zu gestalten.
Eines der bekanntesten Beispiele ist der QbTest: ein computergestützter Aufmerksamkeitstest, der Aufmerksamkeit, Impulsivität und motorische Aktivität mithilfe von Echtzeit-Bewegungserfassung misst. Das Verfahren ist in Teilen Europas für den klinischen Einsatz zugelassen, insbesondere bei Kindern, wird jedoch zunehmend auch bei Erwachsenen angewendet, um quantifizierbare Daten zu Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsniveaus zu gewinnen.
In der Schweiz halten digitale Lösungen schrittweise Einzug in die Routineversorgung von ADHS. Spezialisierte Kliniken wie Sinaps integrieren inzwischen Online-Selbstauskunftsformulare und standardisierte Fragebögen in ihre diagnostischen Abläufe. Diese Systeme ermöglichen eine schnellere Vorabklärung und Triage unter ärztlicher Aufsicht. Für Patient:innen mit langen Wartezeiten auf eine formelle Diagnose schaffen sie eine praktische Brücke zwischen Erstabklärung und umfassender Diagnostik.
Auf internationaler Ebene entstehen zunehmend vollständig digitale Diagnostikmodelle. Ein Beispiel ist die Mentavi Diagnostic Evaluation, die eine asynchrone Online-Diagnose von ADHS im Erwachsenenalter ermöglicht. Aktuelle Validierungsdaten zeigen eine Sensitivität von 80,6 % und einen positiven prädiktiven Wert von 94,9 % im Vergleich zu herkömmlichen Präsenzinterviews. Zwar sind solche Systeme bisher nicht in die öffentliche Gesundheitsversorgung der Schweiz integriert, doch sie spiegeln einen klaren Trend hin zu digital-first-Diagnostik wider, insbesondere für internationale und englischsprachige Patient:innen.
Neuroimaging und neurobiologische Befunde

In den vergangenen zehn Jahren hat die neurobiologische Forschung das Verständnis der ADHS im Erwachsenenalter erheblich vertieft. Ein grosser Teil der heutigen Erkenntnisse geht weiterhin auf Grundlagen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie zurück. Moderne bildgebende Verfahren zeigen, dass die deutlichen Hirnstrukturdifferenzen, die häufig bei Kindern mit ADHS beobachtet werden, im Erwachsenenalter abzuschwächen oder ganz zu verschwinden scheinen.
Meta-Analysen struktureller MRT-Daten zeigen, dass Kinder mit ADHS tendenziell verkleinerte kortikale und subkortikale Volumina in verschiedenen Hirnarealen aufweisen. Im Erwachsenenalter werden diese Unterschiede jedoch weniger deutlich, was auf eine fortgesetzte Hirnreifung bis ins Erwachsenenalter hinweist, ein möglicher neurologischer „Aufholprozess“. Diese Beobachtung deckt sich mit klinischen Mustern, bei denen sich bestimmte Symptome im Laufe der Reifung abschwächen.
Nicht alle Studien kommen zu übereinstimmenden Ergebnissen.. Untersuchungen mit Diffusions-MRT weisen auf anhaltende Veränderungen der weissen Substanz hin, insbesondere in Bahnen wie dem Corpus callosum. Dies weist auf eine mögliche Verschiebung des Entwicklungsschwerpunktwechsel hin: Während im Kindesalter vor allem Unterschiede in der grauen Substanz dominieren, könnten im Erwachsenenalter subtile Anomalien der weissen Substanz die fortbestehenden Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionsprobleme erklären. Laufende Langzeitstudien untersuchen, wie sich diese strukturellen Veränderungen im Verlauf entwickeln und wie sie mit dem klinischen Symptomverlauf zusammenhängen.
Zudem zeigen die Befunde eine ausgeprägte Heterogenität. Bei der Zusammenführung grosser Bildgebungsdatensätze zeigt sich selten ein einheitliches „ADHS-Gehirnprofil“. Unterschiede in Methodik, Stichprobengrösse und klinischer Zusammensetzung tragen zur Vielfalt der Ergebnisse bei. Heute gilt ADHS als neurobiologisch heterogene Störung, beeinflusst durch Subtyp, Geschlecht, Komorbiditäten und bisherige Behandlung. Dieses Verständnis markiert einen Wandel– weg von simplen Gruppenvergleichen hin zu individuellen neuroentwicklungsbezogenen Trajektorien, die die klinische Realität besser abbilden.
Auf neurochemischem Niveau bleibt die ADHS im Erwachsenenalter eng mit einer Dysregulation der Dopamin- und Noradrenalin-Systeme in frontostriatalen Netzwerken verbunden. Die Wirksamkeit von Stimulanzien wie Methylphenidat und Amphetamin stützt diese Hypothese: Beide Substanzen erhöhen die extrazellulären Konzentrationen dieser Neurotransmitter, indem sie deren Wiederaufnahme blockieren und die Freisetzung fördern.
Die aktuelle Forschung bewegt sich zunehmend in Richtung integrierter Modelle, die Bildgebung, Neurochemie und Genetik miteinander verbinden, um zu verstehen, warum Symptome bei manchen Betroffenen persistieren, während sie bei anderen abklingen. Das langfristige Ziel besteht darin, individualisierte Behandlungsstrategien zu entwickeln, die auf den neurobiologischen Profilen einzelner Patient:innen basieren.
Behandlungsoptionen für Erwachsene mit ADHS
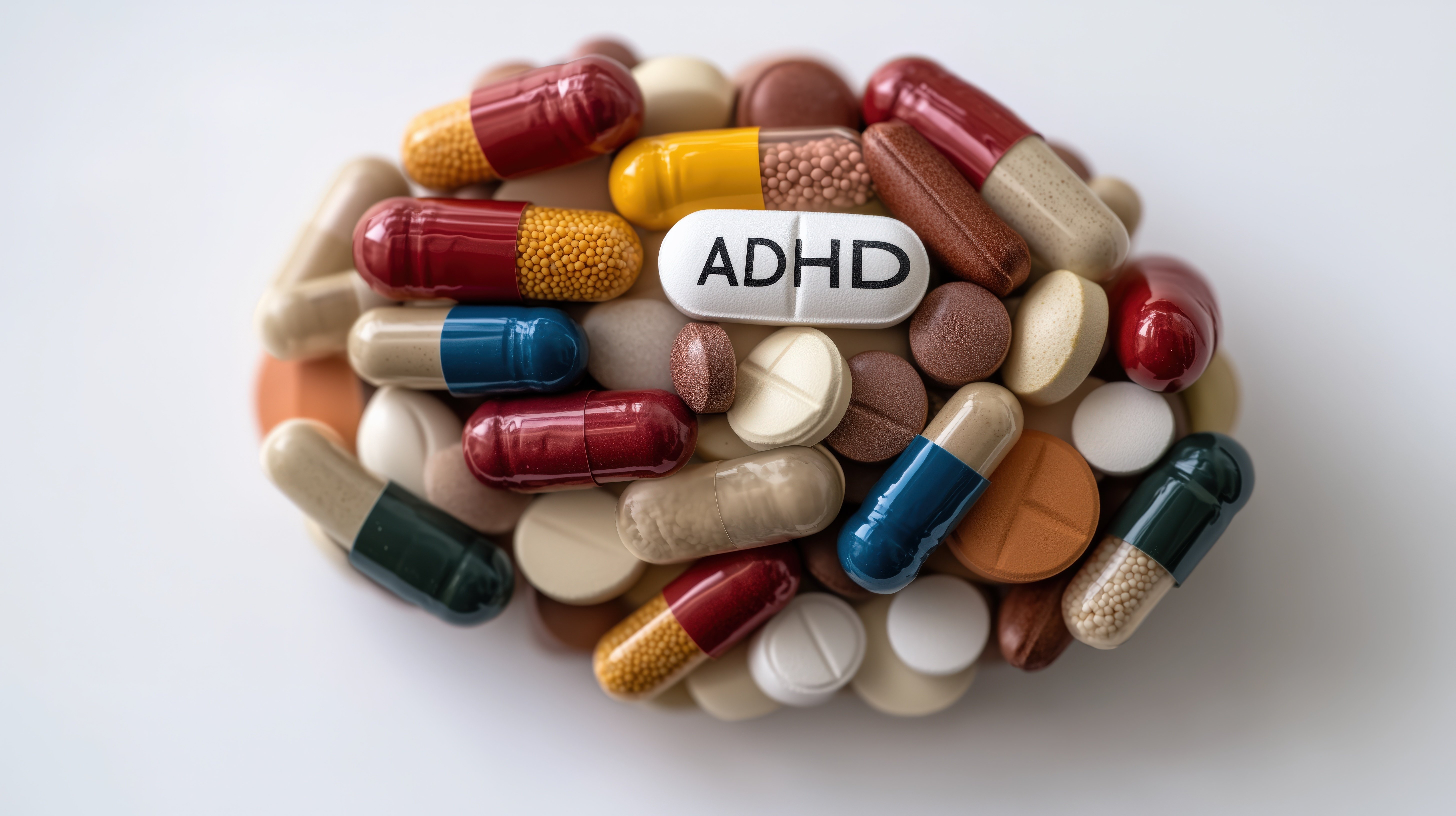
Eine wirksame Behandlung der ADHS im Erwachsenenalter ist in der Regel multimodal aufgebaut. Sie kombiniert medikamentöse Therapie, psychologische Interventionen und strukturierte Anpassungen des Lebensstils. Keine einzelne Strategie ist für alle Betroffenen gleichermassen geeignet – die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Behandlung individuell auf Bedürfnisse, Komorbiditäten und Lebensumstände abgestimmt wird.
Stimulanzien
Stimulanzien bleiben die Therapie der ersten Wahl bei ADHS im Erwachsenenalter und werden durch langjährige Evidenz gestützt. Diese Substanzen greifen in die Dopamin- und Noradrenalin-Systeme der frontostriatalen Netzwerke ein und verbessern Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Impulskontrolle.
Methylphenidat-basierte Medikamente z.B.r Ritalin® oder Concerta® wirken primär, indem sie die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin an der präsynaptischen Nervenzelle blockieren. Klinische Studien zeigen eine hohe Wirksamkeit, mit deutlicher Symptomreduktion und funktionellen Verbesserungen bereits nach wenigen Tagen bis Wochen.
Amphetamin-basierte Präparate (z. B. Lisdexamfetamin, Dextroamphetamin) greifen über einen leicht anderen Mechanismus ein: Sie blockieren nicht nur die Wiederaufnahme, sondern fördern zusätzlich die Freisetzung von Katecholaminen. Einige Patient:innen sprechen besser auf Methylphenidat, andere auf Amphetaminpräparate an – was die Bedeutung der individualisierten Dosiseinstellung unterstreicht.
Die Dosierung und Titration erfordert besondere Sorgfalt. In der Regel wird mit einer niedrigen Dosis begonnen, die schrittweise erhöht wird, bis der optimale therapeutische Nutzen ohne belastende Nebenwirkungen erreicht ist. Regelmässige Verlaufskontrollen sind entscheidend, da sowohl Über- als auch Unterdosierung die Wirksamkeit beeinträchtigen können.
Zur Überwachung gehören eine kardiovaskuläre Basisabklärung, regelmässige Blutdruck- und Pulskontrollen sowie die Beurteilung von Schlafqualität und Appetit. Unter ärztlicher Aufsicht gelten Stimulanzien als sicher, doch bei Patient:innen mit Herzerkrankungen oder erhöhtem Substanzmissbrauchsrisiko ist besondere Vorsicht geboten.
Aktuelle Langzeitdaten (2025) zeigen, dass eine kontinuierliche Stimulanzientherapie bei den meisten Erwachsenen dauerhaft kognitive und funktionelle Verbesserungen erzielt – ohne Hinweise auf eine zunehmende Toleranzentwicklung bei sachgerechter Überwachung. Die besten Behandlungsergebnisse werden jedoch erreicht, wenn die Pharmakotherapie mit verhaltensorientierten Strategien kombiniert wird.
Nicht-stimulierende Medikamente
Für Patient:innen, die Stimulanzien nicht vertragen oder bei denen diese kontraindiziert sind, stehen mehrere nicht-stimulierende Therapieoptionen zur Verfügung.
Atomoxetin, ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, ist die am besten untersuchte Alternative. Der Wirkungseintritt erfolgt zwar langsamer, typischerweise nach mehreren Wochen, doch die Wirksamkeit ist gut belegt, insbesondere bei Erwachsenen mit komorbiden Angststörungen oder Schlafproblemen. Atomoxetin erhöht die Verfügbarkeit von Noradrenalin im präfrontalen Kortex und verbessert so die Aufmerksamkeitsleistung und emotionale Regulation.
Alpha-2-Agonisten wie Guanfacin und Clonidin können sowohl allein als auch in Kombination mit Stimulanzien eingesetzt werden. Sie wirken an postsynaptischen Rezeptoren im präfrontalen Kortex, reduzieren Hyperarousal und fördern das Arbeitsgedächtnis. Aufgrund ihrer sedierenden und blutdrucksenkenden Effekte ist ihr Einsatz jedoch auf bestimmte Patient:innengruppen beschränkt.
Vergleichende Studien zeigen, dass die Ansprechrate auf nicht-stimulierende Medikamente bei etwa 50–60 % liegt, etwas niedriger als bei Stimulanzien. Dennoch bieten diese Substanzen eine wertvolle Behandlungsalternative für Patient:innen, die nicht unter kontrollpflichtigen Medikamenten behandelt werden möchten oder müssen.
Psychologische und verhaltenstherapeutische Ansätze

Psychologische und verhaltenstherapeutische Interventionen spielen eine zentrale Rolle in der Langzeitbehandlung der ADHS im Erwachsenenalter. Sie helfen Patient:innen, eine reine Symptomlinderung in konkrete funktionelle Verbesserungen des Alltags zu übersetzen.
Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), angepasst an die spezifischen Bedürfnisse von ADHS-Betroffenen, konzentriert sich auf praktische Fähigkeiten wie Zeitmanagement, Priorisierung, Emotionsregulation und den Umgang mit selbstkritischen Gedankenmustern. Studien zeigen, dass die Kombination von KVT und medikamentöser Therapie sowohl die Symptomkontrolle als auch die Bewältigungsstrategien deutlich verbessert – stärker als jede dieser Behandlungsformen allein.
ADHS-Coaching bietet eine strukturierte Form von Alltagsunterstützung und Verantwortlichkeit. Coaches helfen Patient:innen, individuelle Organisationssysteme zu entwickeln, unterdessen Planungsroutinen, Erinnerungsmechanismen oder feste Terminstrukturen, die Aufmerksamkeit fördern und Prokrastination reduzieren.
Achtsamkeitsbasierte Interventionen haben in den letzten Jahren zunehmend empirische Unterstützung gefunden. Regelmässiges Achtsamkeitstraining kann Impulsivität verringern, die emotionale Selbstregulation verbessern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Neuroimaging-Studien deuten zudem darauf hin, dass Achtsamkeit die Aktivität in aufmerksamkeitsrelevanten Hirnnetzwerken normalisieren kann.
Der Weg nach vorn für Erwachsene mit ADHS
Bis 2025 hat die Forschung eine Botschaft unmissverständlich klargemacht: ADHS endet nicht mit der Kindheit. Es handelt sich um eine lebenslange neuroentwicklungsbedingte Störung, die sich mit dem Alter und den Lebensumständen weiterentwickelt. Bei manchen Betroffenen klingen die Symptome mit der Reife ab; bei anderen bestehen sie in subtileren Formen fort – überdeckt durch Struktur, Intelligenz oder schiere Anstrengung –, bis die wachsenden Anforderungen des Lebens ihre Auswirkungen offenlegen.
Fortschritte in der Neurobildgebung, Genetik und digitalen Diagnostik vertiefen unser Verständnis dafür, wie sich ADHS im Laufe des Lebens entfaltet. Die Behandlung wird zunehmend personalisiert und multimodal; sie kombiniert pharmakologische, verhaltensbezogene und lebensstilorientierte Ansätze, die das individuelle neurobiologische und psychosoziale Profil jedes Patienten widerspiegeln.
Mit wachsender Aufmerksamkeit erweitert sich auch die Chance auf frühere Erkennung und gezieltere Versorgung. Ärztinnen und Ärzte, die ADHS erstmals im Erwachsenenalter diagnostizieren, stehen nun vor der Aufgabe, ihren Patientinnen und Patienten mehr Selbstbestimmung, Stabilität und Lebensqualität zu ermöglichen – oft nach Jahren unbehandelter oder missverstandener Symptome.
Um über die neuesten Entwicklungen in der ADHS-Forschung bei Erwachsenen, diagnostische Innovationen und Therapieansätze auf dem Laufenden zu bleiben, können sich medizinische Fachpersonen auf just-medical.ch registrieren.
Dort stehen CME-akkreditierte E-Learning-Module, Fach-Webinare und kontinuierlich aktualisierte Einblicke aus der internationalen neuropsychiatrischen Forschung zur Verfügung – speziell kuratiert für Klinikerinnen und Kliniker, die Wissen in bessere Versorgung übersetzen möchten.
Alle Artikel
